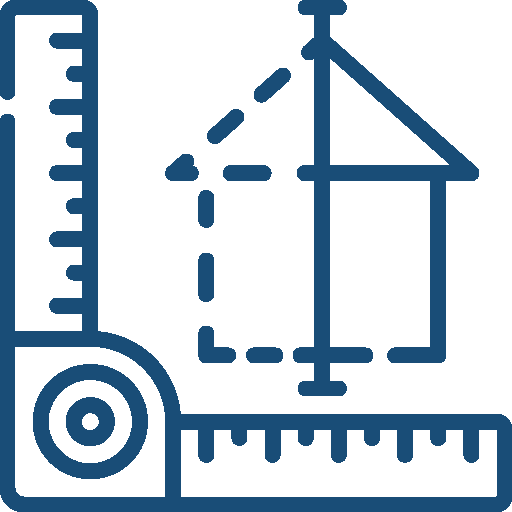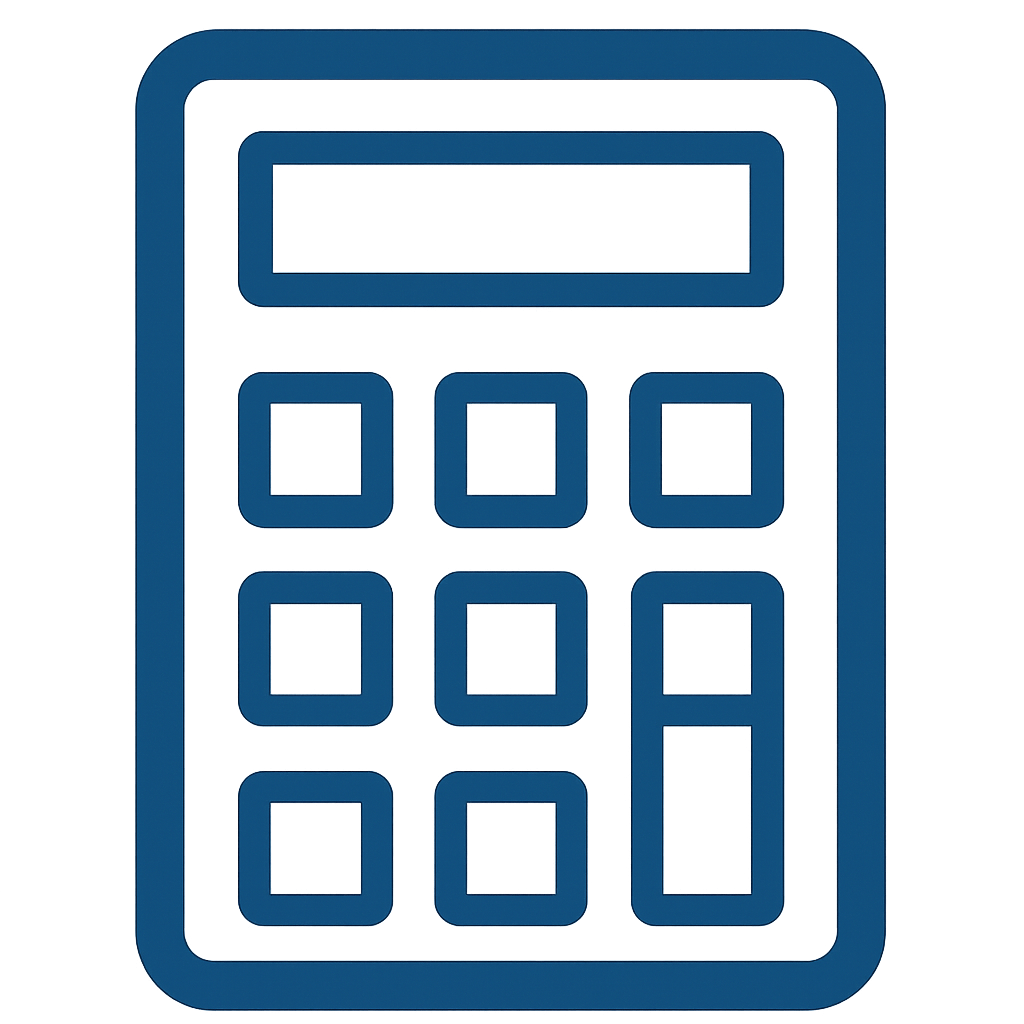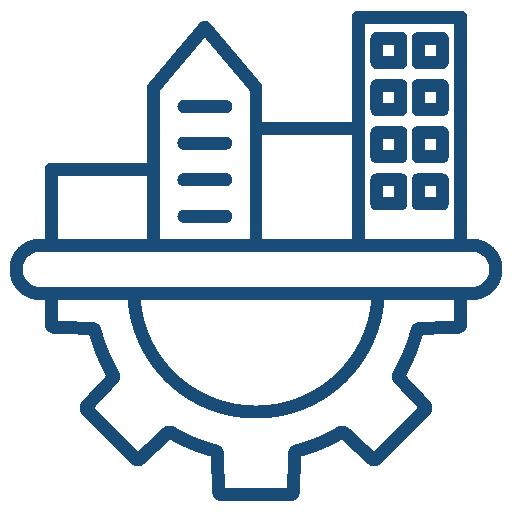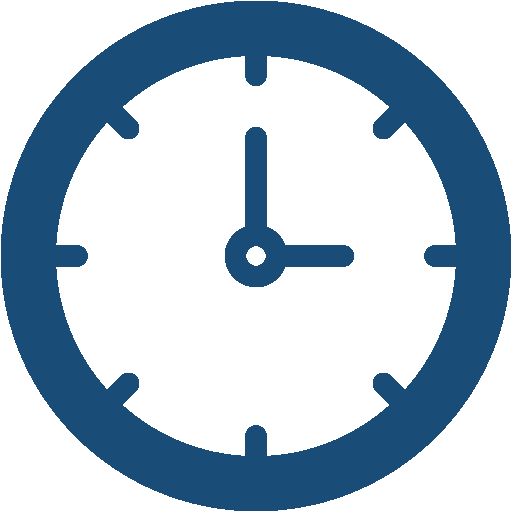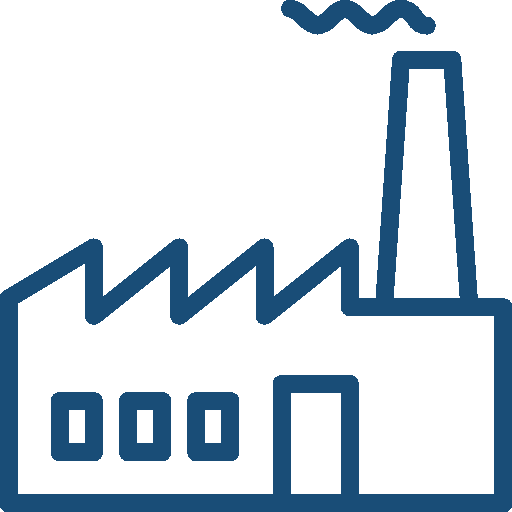Nutzungsart eines Grundstücks ändern: Leitfaden, Gesetze und Kosten in Deutschland

Haus

Wohnung
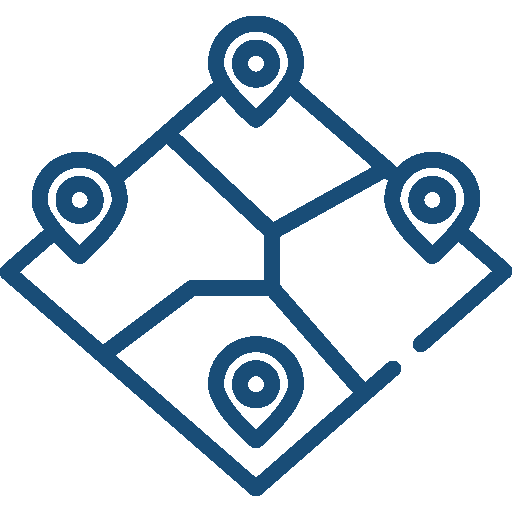
Grundstück
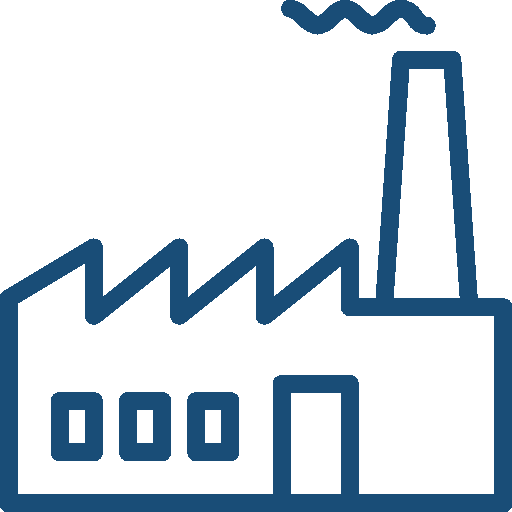
Gewerbe
Wer ein Grundstück besitzt und seine Pläne ändern möchte, stößt schnell auf ein zentrales Thema: die Nutzungsart für das Grundstück ändern. Eine Nutzungsänderung bei Grundstücken ist in Deutschland klar geregelt und kann je nach Art, Lage und Größe komplex sein. Für Eigentümer, Investoren oder Bauherren bedeutet fundiertes Wissen über die Änderung der Grundstücksnutzung weniger Risiken, schnellere Genehmigungen und eine realistische Kostenplanung. Zudem beeinflusst die Nutzungsart nicht nur Bebauungsmöglichkeiten, sondern auch die Grundsteuer – und damit Ihre laufenden Kosten.
Wir haben einen umfassenden Leitfaden für Sie zusammengestellt, der Sie durch den Prozess zur Änderung der Grundstücksnutzung führt und wichtige Fragen zu Kosten, Dauer und Genehmigungen im Vorfeld beantwortet.
Das Wichtigste kurz erklärt
- Die Nutzungsart eines Grundstücks zu ändern heißt, es künftig für einen anderen genehmigten Zweck zu verwenden.
- In Deutschland gibt es verschiedene Nutzungsarten wie Wohnbaufläche, Gewerbefläche oder landwirtschaftliche Fläche.
- Die aktuelle Nutzungsart eines Grundstücks herausfinden, können Sie im Bebauungsplan oder im Flächennutzungsplan Ihrer Gemeinde.
- Die Nutzungsart von Grundstücken beeinflusst die Grundsteuer und damit die Höhe Ihrer Steuerlast erheblich.
Was bedeutet es, die Nutzungsart eines Grundstücks zu ändern?
Die Nutzungsart von einem Grundstück zu ändern, bedeutet, die zulässige Verwendung einer Fläche offiziell neu festzulegen – etwa von landwirtschaftlicher Nutzung zu Wohn- oder Gewerbenutzung. Für diese Nutzungsänderung des Grundstücks ist in der Regel ein Antrag bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde nötig. Diese prüft, ob die Änderung der Grundstücksnutzung genehmigungsfähig ist und legt mögliche Auflagen fest. Eine frühzeitige Abstimmung mit der Behörde sowie die Unterstützung durch Architekt oder Bauingenieur können das Verfahren deutlich beschleunigen.
Die Nutzungsart von Grundstücken beeinflusst die Grundsteuer in Ihrer Höhe. Ein Wechsel der Nutzung kann daher zu einer Neubewertung führen und Ihre jährliche Steuerlast erhöhen oder senken – abhängig von Art und Wert der künftigen Nutzung.
Nutzungsart eines Grundstücks herausfinden: So geht’s
Um die Nutzungsart eines Grundstücks herausfinden zu können, ist ein Blick in die Flurstücks- und Grundstücksnachweise sinnvoll. Diese Unterlagen muss der Grundstücksverkäufer auf Nachfrage vorlegen. Auch im Bestandsverzeichnis des Grundstücksblattes im Grundbuch findet sich oft ein entsprechender Vermerk – jedoch nicht immer in detaillierter Form. Ein weiteres zentrales Dokument ist der Flächennutzungsplan der Stadt oder Gemeinde, der verbindlich festlegt, welche Nutzungen auf bestimmten Flächen zulässig sind.
Ergänzend liefert der Bebauungsplan – vor allem in Städten – präzise Informationen zu den baulichen Regelungen für einzelne Grundstücke oder Stadtteile. Wer sich vorab einen Überblick verschaffen möchte, kann auch die amtliche Liegenschaftskarte nutzen: Hier sind Flächen farblich markiert und beschriftet, sodass sich beispielsweise Siedlungsflächen schnell finden lassen.
Wichtig zu wissen: Die tatsächliche Nutzung kann von der im Flächennutzungsplan vorgesehenen abweichen. In diesem Fall ist eine Nutzungsänderung des Grundstücks möglich, bei der die Änderung der Grundstücksnutzung offiziell beantragt und genehmigt werden muss.
Arten der Grundstücksnutzung
In jedem Bundesland gibt es einen Nutzungsartenkatalog bzw. ein Verzeichnis der Nutzungen, in dem festgelegt ist, welche Grundstücksarten bzw. Grundstücksnutzungsarten erlaubt sind. Meistens handelt es sich um eine der folgenden Gruppen:
- Wohnnutzung: Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke oder Wohnungseigentum
- Gewerbliche Nutzung: Geschäftsgrundstücke, Industriegrundstücke oder Gewerbeparks/Technologieparks
- Landwirtschaftliche Nutzung: Ackerland, Wiesen und Weiden, Weinbau oder Gartenbau
- Forstwirtschaftliche Nutzung: Waldflächen oder Forstliche Flächen
- Sonstige Nutzungsarten: Gemischt genutzte Grundstücke, Sondergebiete, Erholungs- und Freizeitgrundstücke, Straßenland und Verkehrsflächen oder Naturschutzgebiete
Beispiel: Nutzungsart eines Grundstücks ändern
Im Katasteramt wird die tatsächliche Nutzung eines Grundstücks aufgeführt, was statistische und steuerliche Zwecke hat. Jedoch ist es in vielen Fällen möglich, die vorgeschriebene Nutzung zu ändern. Ein klassischer Fall besteht darin, dass Grundstückskäufer eine als Bauerwartungsland gekennzeichnete Wald- oder Landwirtschaftsfläche kaufen und diese mit einem Gebäude bebauen möchten. Es ist wichtig, vor Baubeginn und idealerweise sogar schon vor dem Grundstückskauf beim Katasteramt die aktuelle Nutzungsart zu erfragen und bei Bedarf einen Änderungsantrag zu stellen.
Denn das Katasteramt führt regelmäßige Vergleiche der festgeschriebenen und der tatsächlichen Nutzung von Grundstücken durch – etwa mithilfe von Luftbildern. Wer gegen die vorgeschriebene Nutzungsart verstößt, sollte mit empfindlichen Strafen rechnen.
Nutzungsänderung eines Grundstücks: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wer die Nutzungsart eines Grundstücks ändern möchte, muss in Deutschland ein geregeltes Verfahren durchlaufen. Eine Nutzungsänderung von Grundstücken ist erforderlich, wenn Sie eine Fläche künftig anders verwenden wollen, als es bisher zulässig war – zum Beispiel von einer landwirtschaftlichen Fläche zu einer Wohn- oder Gewerbefläche. Die folgende Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie die Änderung der Grundstücksnutzung Schritt für Schritt erfolgreich umsetzen.
1. Informationen bei der Bauaufsichtsbehörde einholen
Erkundigen Sie sich frühzeitig bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde Ihrer Stadt oder Gemeinde über die rechtlichen Voraussetzungen, den Ablauf und mögliche Gebühren. So vermeiden Sie Verzögerungen und können Unterlagen gezielt vorbereiten.
2. Antrag auf Nutzungsänderung stellen
Reichen Sie einen formellen Antrag ein, in dem Sie die aktuelle Nutzung, die geplante neue Nutzung sowie eventuelle bauliche Veränderungen genau beschreiben. Nutzen Sie bei Bedarf die Unterstützung eines Architekten oder Bauingenieurs.
3. Erforderliche Unterlagen einreichen
Je nach Projekt benötigen Sie Baupläne, eine Betriebsbeschreibung (bei gewerblicher Nutzung), Nachweise zur Bodenbeschaffenheit oder zur Tragfähigkeit sowie Eigentumsnachweise. Prüfen Sie auch, ob eine Vereinbarung der Grundstücksnutzung mit anderen Beteiligten erforderlich ist.
4. Prüfung durch die Bauaufsichtsbehörde
Die Bauaufsichtsbehörde bewertet, ob Ihre geplante Nutzung genehmigungsfähig ist. Dabei werden städtebauliche Vorschriften, Umweltaspekte, Nachbarschaftsbelange und bestehende Bebauungspläne berücksichtigt.
5. Entscheidung und Genehmigung der Nutzungsänderung
Nach der Prüfung erhalten Sie eine Genehmigung oder Ablehnung der Nutzungsänderung Ihres Grundstücks. Bei einer Zustimmung können Auflagen oder Bedingungen vorgegeben werden, die Sie unbedingt erfüllen müssen.
6. Anpassung von Grundbucheinträgen prüfen
Ist die Änderung der Grundstücksnutzung dauerhaft, sollten Sie prüfen, ob Sie den Grundbucheintrag ändern müssen, um die neue Nutzung auch rechtlich abzusichern.
Braucht die Nutzungsänderung eines Grundstücks eine Genehmigung?
Ob Sie die Nutzungsart von Grundstücken ändern dürfen, hängt in Deutschland von klaren gesetzlichen Vorgaben ab. Grundsätzlich ist eine Änderung der Grundstücksnutzung genehmigungspflichtig – vor allem, wenn die neue Nutzung von den Vorgaben im Bebauungsplan oder Flächennutzungsplan abweicht oder bauliche Veränderungen erfordert.
Eine Genehmigung ist in der Regel Pflicht, wenn Sie beispielsweise von einer landwirtschaftlichen Fläche zu einer Wohn- oder Gewerbefläche wechseln oder wenn die neue Nutzung erhebliche Auswirkungen auf die Umgebung hat. Bei gewerblichen Nutzungsänderungen können zudem weitere Genehmigungen anderer Behörden, wie dem Gewerbeaufsichtsamt, nötig sein.
Genehmigungsfrei ist eine Nutzungsänderung meist nur dann, wenn sie im Rahmen der bestehenden Bau- und Nutzungsrechte erfolgt und keine neuen baulichen Maßnahmen erfordert. Trotzdem empfiehlt es sich, vorab immer mit der Bauaufsichtsbehörde zu sprechen, um teure Verzögerungen oder Rückbaupflichten zu vermeiden.
Kosten für die Änderung der Grundstücksnutzung
Der Antrag beim Katasteramt ist kostenfrei und auch bei einer Genehmigung entstehen keine weiteren Kosten. Viele Grundstückseigentümer entscheiden sich jedoch dazu, einen externen Service oder einen Experten in Anspruch zu nehmen, um Zeit und Mühe beim Änderungsantrag zu sparen. Wenn eine Vermessung des Grundstücks nötig ist oder zum Beispiel ein Bodengutachten verlangt wird, steigen die Kosten schnell in die Höhe. Grundsätzlich sollten Eigentümer mit Kosten von mehreren Hundert Euro rechnen, die jedoch nicht an das Katasteramt, sondern nur an den beauftragten Experten gehen.
Manchmal kommt es vor, dass das Katasteramt aufgrund einer Änderung der Grundstücksnutzung dafür sorgt, dass das Objekt an Wert verliert. Wenn es sich um eine wesentliche Wertminderung handelt, hat der Eigentümer das Recht auf eine angemessene finanzielle Entschädigung. Geringe Minderungen hingegen müssen Grundstückseigentümer dulden.
Dauer der Durchführung zur Nutzungsänderung eines Grundstücks
Es ist sinnvoll, erst dann mit dem Bau zu beginnen, wenn die Änderung der Grundstücksnutzung genehmigt und im Grundbuch eingetragen wurde. Dies kann mehrere Wochen und bei manchen Grundbuchämtern sogar mehrere Monate dauern. Für die Änderung ist kein Notar nötig. Grundstückseigentümer erhalten vom Grundbuchamt Auskunft über die erfolgte Änderung und sollten für die Baugenehmigung eine Kopie der Grundbuchseite, die die neue Nutzungsart nachweist, einreichen.
Das Katasteramt selbst ist bei der Genehmigung der Änderung meist schneller. Hier sollten Eigentümer mit ca. 14 Tagen rechnen, wobei bei einem hohen Aufkommen an Anfragen auch ein längerer Bearbeitungszeitraum denkbar ist. Sobald das Katasteramt seine Genehmigung zur Änderung gegeben hat, kümmert sich das Grundbuchamt um die Umtragung im Grundbuch, sodass noch einmal mehrere Wochen vergehen können.
➝ Insgesamt sollten Bauherren bis zu zwei Monate für die Änderung der Grundstücksnutzung einplanen.
Die Rolle von Kataster und Grundbuch bei der Grundstücksnutzung
Das Katasteramt hat die Aufgabe, Daten zu den Nutzungsarten von Flächen zu sammeln und bereitzustellen. Es handelt sich um eine öffentliche Aufgabe. In den letzten Jahren wurde daran gearbeitet, ein Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem für ganz Deutschland einzuführen. In NRW und anderen Bundesländern gibt es die sogenannte Amtliche Basiskarte (ABK). In diesem Dokument können Grundstücksbesitzer einsehen, welche Nutzungsart für ihre Fläche vorgeschrieben ist und ob sich diese eventuell verändert hat.
Wenn sich die Nutzungsart eines Grundstücks ändert, muss das Katasteramt das Grundbuchamt informieren, damit das Grundbuch stets auf dem aktuellen Stand bleibt. Im Grundbuch ist die Nutzungsart unter dem Begriff „Wirtschaftsart“ aufgelistet. Hier stehen meistens Oberbegriffe, während das Katasteramt detailliertere Angaben zur Nutzung (Straße, Fußgängerzone, Parkplatz) macht.
Generell gilt, dass die Art der aktuellen Grundstücksnutzung den Wert des Grundstücks (Einheitswert) nicht verändern kann. Daher muss eine Änderung der Nutzungsart nicht der Steuerbehörde mitgeteilt werden. Es ist nicht möglich, aus der im Kataster nachgewiesenen Nutzungsart Rechtsansprüche abzuleiten – die Regeln des Bauordnungsrechts, der Baunutzungsverordnung und des Baugesetzbuchs sind ausschlaggebend. Das bedeutet zum Beispiel, dass selbst auf einem Siedlungsgrundstück nicht jede Art des Hausbaus erlaubt ist.
Der Bebauungsplans und die Änderung der Grundstücksnutzung
Der Bebauungsplan ist eines der wichtigsten Instrumente der deutschen Stadtplanung. Er gilt in Kommunen oder Stadtteilen und legt fest, in welcher Art und in welchem Maß die bauliche Nutzung erlaubt ist. Die Planung soll eine optimale Nutzung der vorhandenen Ressourcen und des Raums ermöglichen. Für jedes Grundstück innerhalb des Bebauungsplans ist vorgegeben, ob es sich um ein Wohngebiet, ein Gewerbegebiet oder eine andere Fläche handelt, ob, in welcher Höhe und mit wie vielen Geschlossen gebaut werden darf, welches Maß der Flächenversiegelung erlaubt ist und welche maximale Bebauungsdichte umgesetzt werden darf. Rechtliche Vorgaben zum Bebauungsplan finden sich in §9 des Baugesetzbuches sowie in der Baunutzungsverordnung.
Neben Angaben zum Maß der baulichen Nutzung, zur überbaubaren Grundstücksfläche, zur Bauweise und zur erlaubten Grundstücksnutzung legt der Bebauungsplan auch weitere Details fest. Somit soll das Dokument einen verbindlichen Interessenausgleich steuern. Er gibt unter anderem an, wo sich private und öffentliche Grünflächen befinden, welche Verkehrsflächen privat und welche öffentlich sind, auf welchen Flächen Natur und Landschaft im Vordergrund stehen und welche Flächen für die Landwirtschaft reserviert sind. In begründeten Fällen, wie etwa dem Denkmalschutz, ist es möglich, schon im Bebauungsplan verbindliche Vorgaben zur architektonischen Gestaltung von Bauvorhaben zu finden.